0049 821 50 87 53 0
0043 6217 507 22
Montag-Donnerstag: 07.00-16.00 Uhr
Freitag: 07.00-14.00 Uhr
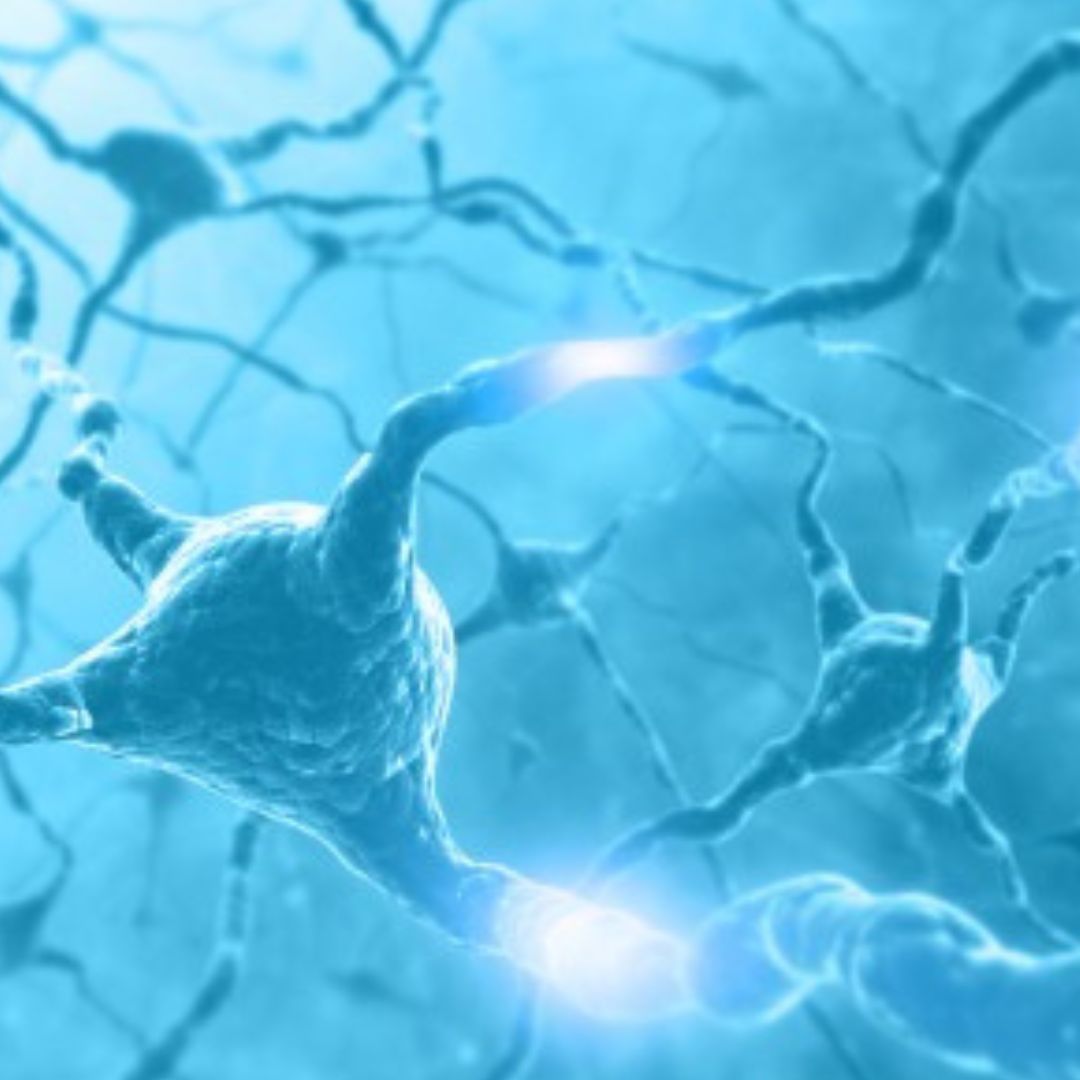
Lithium ist ein (offiziell) nicht essenzielles Spurenelement, um dessen biologische Bedeutung es wissenschaftlich bis heute viel Diskurs gibt. In Hochdosen (600-1200mg/Tag) ist sein Einsatz bei psychischen Störungen wie Depressionen und bipolaren Störungen anerkannt und weit verbreitet. Die gesundheitliche Relevanz von Lithium in ernährungsphysiologisch relevanten Dosierungen (bspw. durch lithiumhaltiges Trinkwasser (1-10mg/Tag)) oder gar die mögliche Essentialität von Lithium hingegen sind stark diskutiert [Hamstra et al., 2023].
In mehreren epidemiologischen Studien wurden interessante Korrelationen zwischen dem Lithiumgehalt in Trinkwasser und der Prävalenz zahlreicher medizinischer Indikationen beobachtet, die eine gesundheitliche Relevanz, sowie eine mögliche Einstufung als essentielles Spurenelement nahelegen.
So ist bekannt, dass Regionen mit höherem Lithiumgehalt im Trinkwasser niedrigere Alzheimer-Sterblichkeitsraten, eine verringerte Krebsinzidenz sowie eine insgesamt reduzierte Gesamtsterblichkeit („all-cause mortality“) aufweisen. Auch über Alzheimer hinaus ließen sich Zusammenhänge erkennen. So korreliert ein höherer Lithiumspiegel im Wasser auch mit einer niedrigeren Inzidenz weiterer psychischer Erkrankungen sowie niedrigeren Suizidraten [Luo et al., 2025; Memon et al., 2020; Kigimiya et al., 2020; Kessing et al., 2017; Chen et al., 2022].
Auffällig dabei ist die wiederkehrende Bedeutung von Lithium für Indikationen der Psyche oder des Nervensystems. Lithium scheint also selbst in niedriger Dosierung neuroprotektive Effekte aufzuweisen, womit die Frage in den Fokus gerückt ist, ob man dieses präventivmedizinische Potential von „low-dose“-Lithium zur Prävention neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer nutzen kann. Angesichts der hohen Prävalenz von Demenz und der enormen Belastung für die Gesundheitssysteme weltweit, ist diese Frage hochrelevant.
Eine aktuelle Harvard-Studie von Aron et al. (2025) zu Lithium und Alzheimer bekommt gerade enorme Aufmerksamkeit. Sie stellt die bislang umfangreichste Arbeit zum Zusammenhang zwischen Alzheimer-Pathogenese und der Bedeutung von Lithium dar. Sie führt Daten aus Humanuntersuchungen, Tiermodellen und molekularbiologischen Analysen (Transkriptom-, Proteom, und Signalweg-Analysen) zusammen. Die Studie könnte die Erklärung für die epidemiologischen Beobachtungen der Vergangenheit liefern.
Die zentralen Erkenntnisse der Studie?
Ein niedriger Gehalt von endogenem Lithium im Gehirn hat einen deutlich signifikanteren Zusammenhang mit der Alzheimer-Pathogenese als bisher angenommen. Lithium könnte ein zentrales Element in der Alzheimer Prävention darstellen und das bereits in niedriger Dosierung.
Im Rahmen der aktuellen Harvard-Studie der Alzheimer-Forschungsgruppe um Prof. Bruce Yanker (“Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease”) wurde eine deutliche signifikantere Beziehung zwischen Lithiumspiegeln und dem Fortschreiten der Alzheimer Erkrankung aufgezeigt als bisher vermutet [Aron et al., 2025].
Post-Mortem-Analysen
Die Arbeitsgruppe verglich Gewebeproben verstorbener Alzheimer-Patienten mit Proben verstorbener Kontrollindividuen ohne Alzheimer. Dabei wurde der Gehalt von 27 Metallen in bestimmten Hirnarealen (PFC und Kleinhirn) mittels ICP-MS analysiert. Von allen untersuchten Metallen war ausschließlich Lithium bei Personen mit „mild cognitive impairment“ (MCI) und Alzheimer signifikant reduziert. Im Falle der Alzheimer Patienten wurde zudem festgestellt, dass die für die Alzheimer-Pathogenese relevanten Amyloid-Plaques Lithium binden und anreichern können. Diese sog. Sequestrierung führt dazu, dass der zelluläre Lithium-Spiegel bei Alzheimer-Patienten sinkt.
Tiermodelle:
Induzierte Lithium-Defizienz
In Alzheimer-Maus-Modellen (3xTg AD & J20 AD) sowie Wildtyp-Mäusen wurde über eine spezielle Diät ein Lithiumdefizit herbeigeführt. Durch die Lithium-arme Diät konnte die Lithium-Konzentration im Serum der Versuchstiere um bis zu 89% und die kortikalen Lithium-Konzentrationen um bis zu 52% reduziert werden.
In den Alzheimer-Modellen führte die Lithium-arme Diät zu einer deutlich beschleunigten Ablagerung von Amyloid-β-Spezies sowie verschiedener Phospho-Tau Isoformen, einen deutlich erhöhten Verlust von Synapsen, Axonen und Myelierung sowie einer erhöhten Aktivierung von Mikroglia (Immunzellen) mit entsprechendem pro-inflammatorischem Phänotyp. Eine entsprechend erwarteter kognitiver Abbau ging mit diesen Veränderungen einher.
Durch den Lithium-Mangel zeigten jedoch auch Wildtyp-Mäuse ein beschleunigtes Auftreten pathogener Amyloid-Spezies wie Aβ40 und Aβ42, eine erhöhte Mikroglia-Aktivierung sowie deutliche kognitive Defizite.
Lithium-Interventionen mit verschiedenen Lithium-Salzen (low-dose)
Da sich natürlich die Frage stellt, ob die Alzheimer-Progression in diesen Modellen durch eine Lithiumgabe verlangsamt werden kann, wurde die Ergänzung von niedrig dosierten („low-dose“) Lithium (in Form von Lithiumorotat (LiO) und Lithiumcarbonat (LiC)) diesbezüglich untersucht. Die Dosis wurde dabei so gewählt, dass man normale physiologische Serum-Lithium-Konzentrationen erreichte.
Die Lithium-Supplementation in den Alzheimer-Modell-Versuchstieren unterdrückte nahezu vollständig die Akkumulation von pathogenen Aβ-Spezies sowie Phospho-Tau. Zudem zeigten die Versuchstiere eine geringere Neuroinflammation und eine verbesserte Myelierungsrate. Bereits bei der niedrigsten getesteten LiO-Konzentration war der Amyloid-Induzierte Abfall der Gedächtnisleistung nahezu vollständig wiederhergestellt. In alten Wildtyp-Mäusen reduzierte LiO die altersbedingte Aktivierung von Mikroglia/Astrozyten und verhinderte den altersbedingten Gedächtnisverlust.
Bei diesen Versuchen war LiO dem klassischem LiC überlegen – die Forscher vermuten hier eine niedrigere Sequestrierungsrate von Orotat-gebundenem Lithium im Vergleich zu ionischem Lithium wie aus LiC.
Molekularbiologische Analysen spezifischer Zelltypen à Identifizierung von Mechanismen
Analysen bestimmter Gewebe- und Zelltypen der Human- und Tierproben zur Aufdeckung der zugrundeliegenden Mechanismen lieferten neue Erkenntnisse über die zellulären Effekte von Lithium in Nervenzellen. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der identifizierten Mechanismen:
Gibt es relevante Mechanismen, die in der Studie nicht verfolgt wurden?
Lithium als Insulin-Mimetikum
Der Literatur ist Lithium in zahlreichen Modellen als Insulin-mimetisch beschrieben. So konnte Lithium bspw. in diabetischen Ratten die Insulin-Sensitivität in Muskelzellen wieder herstellen und die Glykogensynthese verbessern. Ähnliche Daten liegen auch aus Versuchen mit chinesischen Hamstern vor [Rossetti et al., 1989; Hu et al., 1997].
Mitunter (aber nicht ausschließlich) wird dafür die bereits erwähnte GSK3β-Hemmung verantwortlich gemacht (GSK3β hemmt den Insulin/PI3K-Akt Signalweg). Warum ist das jetzt relevant für die Alzheimer-Pathogenese?
Bei Alzheimer wird die lokal im ZNS gestörte Insulin-Signalübertragung („brain insulin resistenz“) als einer der Pathogenesefaktoren der Erkrankung angesehen. Durch diese lokale Insulinresistenz, die auch als „Typ-3-Diabetes“ bezeichnet wird, kommt es vereinfacht zu Einschränkungen im cerebralen Energiestoffwechsel, was wiederum nachhaltig negativ für zahlreiche kognitive Funktionen und Reparaturmechanismen ist [Ahmed et al., 2015; Peng et al., 2024].
Wenn Lithium die neuronale Insulinsensitivität wieder herstellen/verbessern kann, stellt dies somit einen weiteren möglichen neuroprotektiven Mechanismus von Lithium dar.
Fazit:
Zum aktuellen Zeitpunkt ist Lithium in der EU nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Auf Rezept ihres Arztes oder Heilpraktikers können niedrig dosierte Lithium-Präparate über verschiedene Apotheken bezogen werden. Rufen Sie uns gerne an, wir können Ihnen diesbezüglich weiterhelfen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen